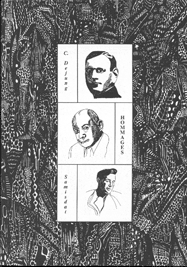 |
Hommages |
Versuch in einer alten Textsorte (1992). Literarische Skizzen über Personen von ungewöhnlichem Mut: Paul Grüninger, Helmuth Plessner, Hans Hutter. Dieses Buch versucht, in einer Zeit moralisierender Geschichtsschreibung eine andere, ungewöhnliche Saite anzuschlagen. Es handelt sich darum, jenen Respekt zu formulieren, der dem ganz ungewöhnlichen Verdienst gebührt. Für den Autor handelt es sich darum, so persönlich zu erinnern und zugleich so allgemein zu schreiben, dass selbst beim Lobpreis die Wahrheit nicht verletzt wird. Was wesentlich ist an den Menschen, kann sich dem lieblosen Auge nicht enthüllen.
Sie finden hier den Text des ganzen Buches in vollem Umfang.
Inhaltsverzeichnis
Paul Grüninger
Helmuth Plessner
Hans Hutter
Paul Grüninger (1891)
geschrieben für Christine
Sein Leben begann 1891, als der noch junge Bundesstaat neben Frankreich die einzige grössere Republik in Europa war und St. Gallen auf dem Höhepunkt seiner Geschichte. Die Stadt zählte gleich viele Einwohner wie 1991, hat aber während der jahrzehntelangen Krise, die genau im Zeitpunkt von Grüningers Tat ihren tiefsten Punkt erreichte, nur halb so viele Einwohner gehabt wie damals und heute. Er wuchs während der Zeit auf, die selbstverständliche Einwanderung in die Schweiz kannte; Reichsdeutsche und Habsburgländische kamen, um in verantwortungsvollen Stellungen dem fleissigen Lande weiterzuhelfen, in bescheidene Berufe drängten sich unter anderem auch Juden aus Osteuropa, von der Arbeiterschaft aber war eine sehr bedeutende Minderheit italienisch. Grüninger stammte aus einer stets von wirtschaftlichen Sorgen bedrängten Kleinbürgerwelt; sein Vater hatte einmal das Geschäft aufgeben und ein anderes beginnen müssen, wie es scheint, nicht ohne Erfolg. Trotzdem: Man muss sich den streng erzogenen Knaben und Halbwüchsigen vorstellen ohne Taschengeld, von der Mutter dazu ausgeschickt, hinter den Fuhrwerken mit einer Schaufel Rossbollen einzusammeln, von den benachbarten Kleinhändlern schon früh gegen ein Stück Brot mit Botengängen beauftragt. Seine ganze Kindheit verbrachte er unter Knaben, denn auch die Primarschule war in der Stadt St. Gallen nach Geschlechtern getrennt. Was sich gehört und was man zu tun hat, wurde in einem protestantischen Curriculum gelernt, dem jede Barmherzigkeit fern, aber eine sehr selbstbewusste Gerechtigkeit heilig war. In dieser Erziehung war zum Beispiel die Onanie von höllischen Drohungen umstellt, und keine Beichte existierte, die der Panzerung wenigstens etwas Alternatives entgegengesetzt hätte. Evangelisch sein, hiess vor allem "frei" sein, aber in diesem Kontext; "never excuse" und "never explain" waren die zum Männlichkeitswahn tendierenden Tugenden; die Sünde eine Privatsache zwischen dem Mann und Gott. Dabei gab es doch auch das "Andere" in der nächsten Umgebung; die zahlreiche Industriearbeiterschaft stammte oft aus der katholischen Landschaft; Grüningers eigentliche Heimat, das Rheintal, war sogar in der merkwürdigen ostschweizerischen Tradition bikonfessionell. Das katholische Element in St. Gallen ist neben der historischen Textilindustrie verantwortlich für die Eleganz der Stadt: Im Turin der Schweiz sind Frauen und Männer besser gekleidet als sonstwo. Eine Universität fehlte der Stadt sehr schmerzlich: Mancher wandte sich den merkantilen Fächern zu, nur um in der Heimatstadt zur zweitklassigen hohen Schule gehen zu können, andere entschieden sich für Ingenieurberufe, um im ungeliebten Zürich wenigstens die Eidgenössische Hochschule zu belegen. Dass Grüninger hätte studieren können, ist glaublich; er wollte es nicht. Wirtschaftlich ging es bis gegen den Ersten Weltkrieg hin, also während der ganzen Kindheit und Jugend Grüningers, gut, wobei an einen konsumorientierten Lebensstil von ihren Wohlstand grell herausstellenden "Beautiful people" nicht zu denken war.
Grüningers Seele wurde sehr männlich, und er war und empfand sich modern gerade in der Zurückweisung des Schulischen. Was er war, wollte er nicht seiner Bildung verdanken. Dieser Zusammenhang ist gar nicht selten bei künftigen Lehrern - diese sind nur auf der Sekundarstufe häufiger von denen, welche sehr gern zur Schule gingen und dann lebenslang an dem Ort blieben, wo sie Erfolg gehabt hatten. Modern war auch Grüningers Hingabe an den Mannschaftssport. Als Fussballer und Fussballanhänger bewegte er sich in einer fortschrittlichen, aber rein männlichen Oeffentlichkeit. Dass er alles recht tat, aber nichts gut, war von der protestantischen Ethik mit vorgeschrieben, und dass ihm dies ein Gefühl von "gesundem Mittelmass" gab, versteht sich von selbst; es war aber keine hart erarbeitete Mässigkeit zwischen den extremen Möglichkeiten der Leidenschaft, sondern eine in der Schweiz häufige demokratische Genügsamkeit. Er wählte (mit dem Fortschritt) die öffentlichen Berufe; das privatwirtschaftliche Erwerbswesen der Kleinbürger, zu dem er in der zweiten Lebenshälfte gezwungen war, mochte der junge Mann als vorgestrig verachten. Grüninger wurde Primarlehrer. Dass er als Bürgerlicher an den Staat glaubte, dem er diente, darf man mehr als vermuten; dass er darum auch im Militär fest mittat, nicht ohne gleichzeitig zu betonen, das militärische Wesen liege ihm fern, kann nicht erstaunen. Ich würde vorschlagen, von einem höchstintegrierten, aber massvollen Ehrgeiz zu sprechen; Rang verdankte sich in seinem Weltbild der Position und dem Charakter, nicht der Leistung; "reine Gelehrte" wie seine Lehrer, "private Kleinunternehmer" wie seine Eltern, "politisch Engagierte" wie viele Altersgenossen kamen ihm rückständig vor. Er trat der freisinnigen Partei bei, und man glaubt ihm gern, das habe nichts bedeutet: Weder ging es ihm um eine politische Karriere im eigentlichen Sinn, noch gar um Ideen; man muss sich einen Mann seiner Stellung als gelegentlichen oder häufigeren Kirchgänger vorstellen; was er da an Ideologie anzuhören hatte, genügte ihm vollauf. Im übrigen zählte zur demokratischen Selbstverständlichkeit, dass man in einem öffentlichen Beruf ein angemessenes Auskommen hatte und lebenslang haben würde. Grüninger lebte mit Pensionsberechtigung - zu einem Zeitpunkt, als dies noch seltenes Privileg war. Kühn wirkt in seiner Biographie nichts.
Was an der Berufswahl gedeutet werden kann, ist die Veranlagung zum Protektor. Der Lehrerberuf erlaubt es, sich zugleich stark und gütig, frei und gebunden zu erleben; um den Preis des dauernden Zusammenseins mit Abhängigen ergab sich die Möglichkeit, zugleich geliebt und gefürchtet zu werden, weltliche Macht und christliche Hilfsbereitschaft zu verbinden. Als Beamter oder Offizier konnte das gleiche erreicht werden, jedoch nur mit grösserer Anstrengung. Streng und gerecht zu sein war für ihn nicht alles, aber eine wesentliche Voraussetzung; die Position lindert die Angst, sodass noch das höchste männliche Ideal, die Hilfsbereitschaft voll ausgelebt werden kann.
So verwirklichte er sich, nachdem er es zum Polizeioffizier und danach bald zum Polizeihauptmann und Kommandanten gebracht hatte. Hochfahrend und erschien er, stark und gütig. Wie der Offiziersrang im Militär brachte jetzt auch die berufliche Stellung Gelegenheit, zu Pferd aufzutreten. Den machiavellistischen Blick auf Fehler und allfällige Unzufriedenheit der direkten Untergebenen, erst recht den auf die Berater und Günstlinge der Vorgesetzten mied er. Ein Mann des Apparates war er nicht. Dafür war er gütig zu den Kleinen, in diesem Amt nun zu den einfachen Landjägern.
Die Polizei genoss in jener Zeit uneingeschränkten Respekt. Die Kinder wuchsen mit Mythen von Verbrechen, Verfolgung, Gefängnis und Ordnungsgewalt auf, die schon in frühesten Jahren das Bild von der Welt prägten. Warum ist Grüninger Polizist geworden, was zog ihn dahin? Man wird es ihm kaum glauben, dass er "nur wegen des Lohns" von der Schule, die er liebte und wo er Erfolg hatte ("kein Schulmeister, sondern ein Meister der Schule"), zur Polizei gegan-gen sei. Autorität war da wie dort erforderlich, aber die protegierende Güte konnte man in der Schule ohne Zweifel besser ausleben. Vielleicht spielte der erste Weltkrieg eine Rolle, lange Jahre in der Männerwelt, die für den Leutnant und Oberleutnant vermutlich auch viel lustige Verantwortungslosigkeit und mit Glück gefüllte Langeweile enthalten hat. Dass er dabei immerhin die Not der Leute sah, auch die seiner Soldaten, ist verbürgt; dass er sein protegierendes Wesen zum Zug kommen liess, dürfen wir annehmen. Nicht erschüttert wurde sein Weltbild durch den Landesstreik, hier empfand er so bürgerlich wie seine ganze Umwelt; man wird seinem Entgegenstehen zur politisch "anderen Seite" niemals einen Zweifel anmerken.
Immerhin gibt es einen Beweis, dass das von mir vermutete Motiv, zugleich stark und gütig zu sein, wichtig war: Kaum war Grüninger im neuen Amt, begannen Aktivitäten nach aussen, wie wir sie aus der späteren Zeit gut kennen: Die Polizei will in der modernen Welt nicht nur gefürchtet, sondern als Freund und Helfer anerkannt sein. Das war in vielem Grüningers Sache. War er schon beim Fussballclub Brühl in Männergruppen aktiv gewesen, so wurde er jetzt zum Vereinsmeier in all jenen Belangen, die mit dem Schutzauftrag der Hermandad zu vereinigen waren. Oeffentliche Vorträge über Verbrechensvorsorge und Schutz vor Kriminalität hielt er, wo man ihn hören wollte. Ueber die Polizeihundeführer-Vereinigung gelangte er zum Tierschutz, wo er im Augenblick seines Sturzes dem schweizerischen Verbandsvorstand angehörte. Mit entschlossener Initiative nahm er sich der Verkehrserziehung an, die er überall in seinem Kanton persönlich durchführte, die "moderne" Leidenschaft für das Automobil mit der Sorge für den Schutz der Schwachen verbindend. Viele neideten ihm dieses öffentliche Auftreten, hielten seine Aktivitäten für Zeichen des Ehrgeizes und der Selbstdarstellungssucht. Dass es ihm aber um mehr ging, scheint glaubhaft. Natürlich sind die Schwierigkeiten, die seine Unteroffiziere mit ihm hatten, auch durch sein Auftreten mit verschuldet gewesen.
Man hat ihm in entscheidender Stunde zugute gehalten, dass er zwei Seiten gehabt habe; das wird sich darauf bezogen haben. Formell ein Freisinniger, galt er als "rechts", und sein herabsetzendes Wesen fügte sich für die Umwelt gut dazu. Grüninger war sehr grob, seine Selbstsicherheit als Chef grenzte an Ueberheblichkeit. "Das berühmte Wort" bei ihm, das alle kannten, hiess "Blödsinn", damit schmetterte er alles ab, was ihm nicht passte. Zugleich scheint er in seiner protegierenden Art auch viele unter sich gehabt zu haben, die ihm dankbar waren oder hätten dankbar sein müssen. Zu den guten Seiten zählte man offenbar die Strenge; er hat "geführt" in einer Zeit, die kooperative Führung gar nicht kennen wollte. Ferner traute man ihm, wie dem allzu strengen Lehrer, ein "gutes Herz" zu. Unsicher war er nicht.
Die protegierende Haltung brachte natürlich die Möglichkeit und auch Vorwürfe der Bevorzugung einzelner; das ist von heute her nur richtig zu werten, wenn man bedenkt, welches Prestige eine einfache Staatsstelle zu jener Krisenzeit hatte. In der "Affäre Grüninger" flogen dann solche Vorwürfe hin und her: Dem Polizeikommandanten wurde vorgeworfen, er habe Fussballkameraden von FC Brühl bevorzugt, dem Landammann des Kantons St. Gallen warf Grüningers Seite umgekehrt vor, Parteigenossen protegiert zu haben. Beides dürfte zutreffen, aber nie das Ermessen der Machtträger überschritten haben. Peinlich war es in den Fällen, wo man die mit schwachen Zeugnissen aufgenommenen nachher "anderswo" in der staatlichen Verwaltung unterbringen musste; dies geschah in den Fällen, wo Regierungsrat Keel seine Stellung gebraucht hatte, nicht in den Grüninger angelasteten. Generell darf man diesen Vorwürfen nicht zuviel Gewicht geben; begreiflicherweise hat sich die natürliche Neigung zum Neid in der Wirtschaftskrise sehr verschärft.
Alle Probleme spitzten sich im letzten Amtsjahr des "unglücklichen" Polizeikommandanten zu. Es kam zu "Fällen" in der St. Galler Kantonspolizei, die wie Vorboten des grossen Skandals erscheinen; an Emigranten aus dem Reich wurden Papiere verkauft; Leute, die Emigranten gegen Entgelt geschleppt hatten, kamen vor Gericht. Besonders unglücklich erwies sich die Person des zweiten Offiziers (des Polizeileutnants); dieser scheint in jeder Hinsicht ungeeignet gewesen zu sein für seinen Posten. Ein Urteil über ihn fand später allgemeine Zustimmung: Er habe die schlechten Eigenschaften des Kommandanten zwar übernommen, seine guten aber nicht. Er liess sich von einer entlassenen Strafgefangenen in verfänglicher Situation die Pistole stehlen und verhielt sich offenbar so anstössig, dass er während der Untersuchung gegen Grüninger, wo vielerlei Unregelmässigkeiten zum Vorschein kamen (und zwar nur bei ihm, nicht aber beim angegriffenen Vorgesetzten), sehr leicht zum Rücktritt veranlasst werden konnte. Die Untergebenen sprachen vom Kommandanten als dem "grossen Paul", dem Leutnant als dem "kleinen Paul"; Vorwürfe mangelnden Respekts und schlechten Lebenswandels fielen, als man den Polizeihauptmann mit allen Mitteln schlecht zu machen suchte, auf ihn sehr viel deutlicher als auf den, von dem ich berichte. Zu all dem kam noch dazu, dass der Kommandant den Unwillen der Untergebenen noch steigerte, indem sie zum Polizeisport mehr oder weniger befohlen wurden. Hier war die Lust Grüningers, seinen Untergebenen "Einsatz" abzuverlangen, begreiflicherweise verhasst. Und wie geschaffen, noch mehr Missstimmung zu verbreiten kam in der Vorkriegsphase eine neue "freiwillige" Leistung in Betracht: Der Luftschutz. Grüninger hatte an dieser Aufgabe selbstverständlich ebenfalls Gefallen, er selbst versuchte sich für diese Aufgabe zu befreien, und verpflichtete offenbar mehrere Unteroffiziere auch dazu. Grüninger hielt dies für wichtiger als alles andere, und wenn man dies von den folgenden Kriegsereignissen her beurteilt, zu Recht.
Es ist nicht wahrscheinlich, dass Grüninger viel bemerkte vom Unwillen, den er beim Kader seines Korps erregte. Ein Unteroffizier behauptete später, der Hauptmann sei jeder Diskussion ausgewichen; er hatte für einen Rapport einen ganzen Beschwerdetext vorbereitet gehabt. Darin war vor allem davon die Rede, dass die Offiziere mehr Zeit für die direkt Unterstellten haben müssten, ferner von der fehlenden polizeitechnischen Weiterbildung. Grüninger hätte wohl auf diesen Vorstoss abschätzig geantwortet; das erwarteten auf alle Fälle seine Untergebenen. Warum er aber 1938 nie mehr Zeit hatte, und warum er möglicherweise noch weniger zugänglich war als man von ihm hätte erwarten dürfen, erklärt sich bereits aus seiner Tat.
Grüninger war kein Spiesser; Spiessertum umgab ihn hautnah, und er verachtete das einfach. Dass er sich sehr selbstsicher fühlte und nach oben und unten niemandem wirklich Rechenschaft schuldig, galt ihm und wohl noch vielen als Charakterstärke. "Mir kann niemand etwas anhaben", scheint sein Lebensgefühl gewesen zu sein, "meine Pflicht ist es, den Untergebenen möglichst unan-genehm zu sein " und: "So bin ich nun einmal, und schliesslich bin ich der Chef"; wobei diese Linie vielleicht ein ganzes Beamtenleben hindurch verhalten hätte, wenn nicht...
Mit der heimlichen Unzufriedenheit der Unteroffiziere, der politischen Unbeliebtheit bei der Linken, mancher von Neid gespiesenen üblen Nachrede hätte er leben können. Er behandelte viele in seiner Umwelt als Subjekte; umgekehrt galt er auch als das, was man nur in der wohlmeinend-groben schweizerischen Militärsprache sagen kann: Als "dummer Siech". Sein gutes Herz war sicher geborgen in einer eisernen Haut.
In diesem Jahr 1938 kam aber seine Tat dazwischen.
Die Tat lässt sich klar umschreiben. Als die Flüchtlingspolitik genau zu dem Zeitpunkt international und schweizerisch restriktiver wurde, wo die Judenverfolgung sich im Machtbereich Hitlers verschärfte, liess er eine unbekannte Zahl von Asylsuchenden heimlich in den Kanton St. Gallen einreisen, wobei er versuchte, auch ihre rasche Weiterreise (nach Palästina) zu gewährleisten, sodass wenn möglich gar niemand etwas hätte merken sollen. Für den kantonalen Hauptverantwortlichen in Emigrantenangelegenheiten eine selbstverständlich un-erwartete, völlig illegale Handlungsweise. Man muss dabei bedenken, dass "niemand" zu dieser Zeit das Wesen der Judenverfolgung erkannte, und dass die ganze Welt sich den jüdischen Flüchtlingen verschloss; wir beschreiben ja die Ereignisse des Jahres der Flüchtlingskonferenz von Evian. Im Licht der Shoah erscheint dieses Verhalten natürlich vollkommen anders als im Zeitpunkt, als es geschah.
Wie kam es zu dieser Tat? Wir wissen es nicht. Biographisch liegen die Dispositionen dazu vor, intern von seinem Bedürfnis her, Protektor zu sein, extern von seiner Rolle als mächtiger Beamter. Denn er und nur er konnte diese Tat tun. Zu erwarten war sie selbstverständlich nicht von ihm, so wenig wie von irgendjemandem; denn diese Tat verlangte die grösste Umsicht, Frechheit und Festigkeit, sollte sie niemanden mit Argwohn erfüllen, während sie geschah... Die Tat war für Grüninger als Möglichkeit programmiert, denn der Polizeikommandant und nur er konnte helfen. Ihm war das ganze Flüchtlingswesen, und das heisst im Wesentlichen der Vollzug der Weisungen Heinrich Rothmunds, des Chefs der Eidgenössischen Fremdenpolizei, anheimgestellt. Ein Untergebener konnte vielleicht einzelne Personen schmuggeln; ein Vorgesetzter bestimmte Freipässe ausstellen - aber die massenhafte Verletzung der gültigen Regeln, und das am hellichten Tag, konnte nur er decken. Und er konnte es nur, weil er dieses merkwürdige Doppelansehen hatte; hätten ihn nämlich seine Untergebenen für korrupt gehalten, wäre er sofort verraten worden. Nur weil sein "gutes Herz" glaubwürdig war, halfen viele Untergebene mit (denn seine Tat wäre auch nicht möglich gewesen ohne deren Hilfe), während die weniger Betroffenen zu seinen Gunsten schwiegen. Dass der selbstherrliche Kommandant so handelte, wurde ihm zugestanden.
Er kam gewiss nicht nach einer rationalen Ueberlegung, nicht nach einem Plan oder einer bewussten sittlichen "Entscheidung" zu seiner Tat. Es ist glaubhaft, dass er zuerst einfach sah, was seine Landjäger nach dem Willen des Gesetzes tun sollten - nämlich Leute durch das Gewässer des Alten Rheins ausschaffen, direkt in die Hände der ehemals vorarlbergischen, jetzt reichsdeutschen Häscher, die man gut sehen und höhnisch herumschreien hören konnte. Seine Tat begann mit dem Gefühl: "Das nicht!" und entwickelte sich dann nach eigenen Gesetzen. Sie geschah zunächst sicher ohne Kontakt zu andern, die helfen wollten, und auch ohne bewussten Zusammenhang mit den im Hilfswesen engagierten Juden, Christen und Sozialisten; sie geschah ohne jede Kongruenz mit seinem übrigen Handeln; nur kam es ihm nun sehr zugute, dass er längst schon aufgehört hatte, schriftlich zu notieren, was er tat, wohin er mit dem Auto fuhr, mit wem er sprach. Noch viel weniger als ethische Planung stand politische Ueberzeugung hinter seiner Tat; höchstens verliess er sich auf das Gefühl, als Untergebener eines sozialdemokratischen Regierungsrates, der auch schon politischen Flüchtlingen geholfen hatte, sei er in seinem Tun ungefährdet. Dass die Juden nicht als politische Flüchtlinge galten - auch der Linken nicht, die vielleicht nur eine Spur weniger antisemitisch war als der Volksdurchschnitt, - kümmerte ihn nicht, weil er einfach die empörend unwürdige Handlungsweise vermeiden wollte, zu der ihn klare Weisungen und seine Dienstpflicht gezwungen hätten.
So handelte er, und aus einem Impuls wurde eine länger dauernde, schliesslich über ihn hinauswachsende Tat, eine unvergessliche und eigentlich fast unbegreifliche, die natürlich nach dem Krieg, nachdem aus Verfolgung Vernichtung geworden war, plötzlich zur ganz grossen wurde. Grüninger handelte kaltschnäuzig und warmherzig zugleich, fast wie ein Kinoheld, und er fand monatelang Wege, sein Handeln unauffällig erscheinen zu lassen und das vorhersehbare Ende hinauszuzögern. Die Tat muss bald nach dem 18. August 1938 begonnen haben, dem Datum des Fremdenpolizeibeschlusses, keine Juden mehr hereinzulassen. Sie stand nicht nur gegen das allgemeine Gefühl in der Schweiz, das jüdischen Flüchtlinge noch weniger wohlwollte als den andern, sondern gegen den Konsens der ganzen Welt. Auf der Konferenz von Evian lehnten es alle Länder ab, Quoten von Fluchtwilligen zu akzeptieren, ausser einigen mittelamerikanischen Republiken, deren Pässe ganz offensichtlich nur zur Tarnung der Flucht nach Palästina gebraucht wurden. Die einzigen, die mit Grüninger sympathisierten (ausser den Geretteten und ihren Helfern), waren die Nationalsozialisten, die damals ja "nur" Juden loswerden wollten; hier gab es vielleicht sogar Stellen, mit denen Grüninger sich verständigen konnte, was ihn prompt später verdächtig machte. Grüninger hatte Verwandte in Bregenz, was Grenzfahrten tarnen konnte, auf denen er stets mit unüberprüfter Begleitung im Amtsauto die Grenze passierte. Schliesslich, zwei Jahre nach dem Skandal, wurde er sogar (durch den militärischen Nachrichtendienst) in einer Fiche der Nationalsozialisten im Kanton St. Gallen geführt. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Eintrag irrtümlich oder böswillig entstanden ist, Grüninger blieb er sein Leben lang verborgen, sodass er sich nicht wehren konnte. Helfer fand er bei der israelitischen Flüchtlingshilfe in St. Gallen und bei einer Palästinainformation genannten Tarnorganisation in Zürich. Er selbst veranlasste, dass die Einreisen falsch datiert wurden und dass Leute Ausweise oder ausweisähnliche Schutzbriefe bekamen, die er nicht hätte ausstellen dürfen. Die Weiterreise geschah verhältnismässig schnell und in grossen Gruppen. Sie war nicht gratis; dass aber der Polizeikommandant seine Mitarbeit hätte bezahlen lassen, wurde nie angenommen; der Versuch, ihn herabzusetzen, war so umfassend angelegt, dass man dies sicher aus keinem andern Grund überging, als weil er eben "sauber" geblieben war. Vielleicht wurde sogar im Reich geworben für dieses Schlupfloch; auch auf den Polizeikommandanten selbst fiel der Verdacht, in ganz Süddeutschland Interessenten gesucht zu haben, ein Verdacht, für den es aber nicht den geringsten Beweis gab.
Man schätzt die Zahl der Geretteten Personen auf 2000 bis 3000; zu verifizieren ist das nicht, weil es Grüninger verstand, die Spuren schon während seiner Tat zu verwischen. Eine Steigerung gab es nach dem 9. November 1938, und Grüningers Büro soll danach sehr häufig von Menschen belagert gewesen sein, was auch Valentin Keel, dem vorgesetzten Regierungsrat, nach seiner Meinung hätte auffallen müssen. Grüninger fühlte sich von oben und unten gedeckt. Auf jeden Fall war die Sache so gross geworden, dass jemand meinte, Grüninger müsste sich wie Goethes Zauberlehrling fühlen. "Es ist ihm etwas über den Kopf gewachsen" erklärte der Leiter der Flüchtlingshilfe im Bestreben, ihn nicht zu belasten und an der Vertuschung mitzuwirken.
Dann griff Bern ein. Der Tip kann nicht aus dem Polizeidepartement gekommen sein, jedenfalls nicht von Untergebenen, die alle in dieser Sache dicht hielten, wohl auch nicht von Regierungsrat Keel, der sich überrascht gab. Eine Klarstellung wurde von Grüninger verlangt, und bei der nun erzwungenen Offenlegung beging er einige sehr auffällige Fälschungshandlungen, die später zur Begründung der Verurteilung dienten, die aber vom Täter her den Zweck hatten, den ganz offensichtlich viel grösseren Umfang der Tat zu verdecken. Die stümperhaft erscheinende Fälschungsaktion fiel auf, und obwohl ihr Ergebnis "stimmte" (man meldete die Zahl von gut eintausend Emigranten im ganzen Kanton), veranlasste der Regierungsrat eine Ueberprüfung Grüningers Vorgehen. Die schnell abgeschlossene Untersuchung ergab den Tatbestand der zwei klaren Fälschungen, die nun entweder als Amtspflichtverletzung oder als Betrug zu bezeichnen waren, dazu einen Wust unbelegter Vermutungen, von denen später nichts mehr in der (vom gleichen Untersuchungsrichter ausgeführten) Strafuntersuchung bestätigt werden konnte. Oeffentliches Aufsehen erregte die schnelle Entlassung, fast ohne Anhörung Grüningers, und danach in der monatelangen Untersuchung der hektische Versuch, Rechtfertigungen für die strenge Massnahme zu finden.
Die "Tat" blieb darum im Wesentlichen verborgen. Die viel grössere Zahl der heimlich eingeschleusten Menschen blieb ausserhalb des Kreises der Beteiligten unbekannt. Bern wurde durch den Kanton St. Gallen irregeführt. Das Vorgehen der Justiz erlaubte es, den "grossen" Skandal zu vermeiden auf Kosten der hauptverantwortlichen Person. Es rettete Valentin Keel, aber es rettete in erster Linie auch die Flüchtlinge. Der Regierungsrat erklärte groteskerweise, Grüninger habe "ein weniger schlimmes Vergehen durch ein Schlimmeres gedeckt"; damit war die Vertuschung perfekt. Aus Amtspflichtverletzungen und Vertuschungshand-lungen wurde damit ein "schweres Verbrechen", das das eigentliche, die illegale Schleusung Tausender, verbarg.
Mitspielen musste natürlich der Täter, dem man indessen nicht einmal das Gefühl geben musste, auf seiner Seite zu sein. Und weil Grüninger angeblich gesagt haben sollte (!), wenn es ihn "butze", dann "butze" es auch den Regierungsrat Keel, beschloss man, ihn zu psychiatrisieren.
Das geschah nicht, wie oft überliefert und auch von Grüninger selbst später so dargestellt, unmittelbar nach der Amtsenthebung, sondern erst in der Strafuntersuchung, die - wie vielleicht nicht erwartet - bei den "gewöhnlichen" Vorwürfen rundum Entlastung brachte. Wahrscheinlich war jetzt allen klar, dass man Grüninger mit der Absetzung Unrecht getan hatte, und dass vor Gericht nur ein sehr mildes Urteil zu begründen war; so hätte man mit dem Mittel des "blauen Weges" ihm vielleicht sogar eine Frühpensionierung ermöglichen können. Dass der Sekretär des Polizeidepartements und der ausserordentliche Untersuchungsrichter, die beiden "Gegner" des Angeklagten, solche Schonung im Sinn hatten, ist allerdings zu bezweifeln. Erstens war damals die Psychiatrie noch eine bürgerliche "Schande", zweitens stand gewiss auch das Kalkül im Raum, dem Risiko eines Prozesses vorzubeugen. Es wäre ja möglich gewesen, dass Grüninger mit einer Flucht nach vorn die ganze Tat eingestanden und damit auch seinen Vorgesetzten und viele Flüchtlinge mit ins Verderben gezogen hätte. Zur Hospitalisierung allerdings bot der Bezirksarzt nicht Hand, er verweigerte in einem harschen Schreiben die von ihm begehrte Einweisungsverfügung mit dem Hinweis, Grüninger sei völlig bei Sinnen. Dieser seinerseits versuchte, so wenig wie möglich offenzulegen und brachte es fertig, dass am Ende nur von zwei Einzelfällen und dem unangenehm hohen Stand von 1000 Asylanten im Kanton St. Gallen die Rede war. Jetzt, am Ende, wurde seine Tat ganz gross, indem er im Interesse der Geretteten es auf sich nahm, als einziger Schuldiger dazustehen. Wahrscheinlich hoffte er, gnädig behandelt zu werden, und diese Hoffnung wurde denn auch nicht enttäuscht. Das Urteil war für ihn gerecht: Er hatte ja nicht nur etwas Gutes getan, sondern auch massiv das Gesetz verletzt. Er wird im Moment froh gewesen sein, so milde bestraft worden zu sein und im Urteil sogar noch Anerkennung für seine Menschlichkeit zu lesen; dass dies später ein Leben als Versager und Verfemter bedeuten würde, konnte er weder vorauswissen noch wirklich berücksichtigen. Dass er abgesehen von ganz unentschlossenen Versuchen, seinem Chef ähnliche Taten "vorzuwerfen", nicht für sich kämpfte, kann damit am besten erklärt werden, dass er sich selbst für gleichzeitig moralisch im Recht und bürgerlich für schuldig hielt.
So enthält schon das Strafurteil alle Anerkennung, die im Rahmen des Gesetzes möglich ist für jemanden, der eine massive Wi-derstandshandlung begangen hat, und unter dem Hinweis, dass die Entlassung eine überaus strenge Disziplinarmassnahme gewesen sei, wurde nur eine kleine Geldbusse ausgefällt.
Die Sünde, sagten wir, ist im protestantischen System ein Privatverhältnis zwischen dem Menschen und Gott. Wer kann es Grüninger verdenken, dass ihm auch seine Tat zum privaten Bezug zu Gott wurde? Er verzichtete auf Appellation, später auf jeden Kampf für sich selbst, und trotz der während zwanzig Jahren masslos auf ihn auf ihn zurückfallenden gesellschaftlichen Konsequenzen auf die Forderung, man müsse endlich einmal darauf zurückkommen. Die Ehrungen aus dem Ausland kamen für ihn unerwartet, die schweizerische Diskussion um seine Rehabilitierung erlebte er kaum mehr. Dass er es nicht geschafft hat, in der doch wirtschaftlich günstigen Nachkriegszeit wieder Boden unter die Füsse zu bekommen, schien ihm Schicksal, und es war das auch, wenn wir bedenken, dass er nichts anderes gelernt hatte, als "Beamter" zu sein. Kein Zufall, dass ihm erst der Lehrermangel des Hochkonjunkturjahrzehnts im AHV-Alter wieder ein rechtes Einkommen brachte, als Verweser in ländlichen Schulhäusern...
Die Tat aber, die so viel grösser war als er selbst wissen konnte, entglitt ihm ebenso unvermerkt, wie sie ihm geworden war. Das einzige, was er zu sagen wusste, in allen späteren Gesprächen, war ein ergeifendes "Ich würde es wieder tun", in dem sich wenigstens eine Ahnung von der Grossartigkeit seines Mutes spüren lässt.
Grüninger ist zu rehabilitieren, selbstverständlich. Er ist nicht zu rehabilitieren, weil er ein christliches Gewissen hatte, er ist erst recht nicht zu rehabilitieren, weil er ein "guter Mensch" gewesen wäre. Das sind seine sozialdemokratischen und polizeigewerkschaftlichen Gegenspieler vielleicht auch gewesen. Er ist zu rehabilitieren wegen seiner Tat, in voller Anerkennung seiner Tat. Dass dies bedeutet, in der Demokratie ein Widerstandsrecht zu bestätigen, ist klar. Die Situation, in der er handelte, war nämlich nicht anders als die zu jeder anderen Zeit, in Krieg oder Frieden. Wer weiss denn, ob nicht in wenigen Jahren wieder ein Holocaust passiert? Als Grüninger Menschen rettete, wusste niemand so etwas voraus, genau wie heute. Juden waren unerwünscht, das war alles, was weltweit klar war. Wer aus legalistischen Argumenten das Widerstandsrecht mit der Demokratie für unvereinbar hält, muss uns sagen, wieviele gerettet worden wären, wenn Grüninger eine Beschwerde oder eine politische Initiative gegen Rothmunds Flüchtlingspolitik gemacht hätte. Und er wird zugeben müssen, dass ihm dreitausend gerettete Menschen nichts bedeuten.
Helmuth Plessner (1891)
geschrieben für Regula
Unter den Menschen, die uns zu Vorbildern geworden sind, gibt es zwei Gruppen. Die einen waren uns zuerst ziemlich gleichgültig, vielleicht auch in unverbindlicher Art sympathisch. Beim näheren Kennenlernen, zum Beispiel an einem wichtigen Tag, in einer Grenzsituation, wurden sie plöztlich unvergesslich. Andere Menschen waren uns zum vornherein überlegen, gaben uns durch das, was wir über sie wussten, Masstäbe und Energien; doch waren sie auch darin vorbildlich, dass sie uns enttäuschten, uns freiliessen. Am Anfang des Lebens ist uns der zweite Typus bekannter und häufiger, doch mit der Zeit werden die Begegnungen, die nach dem ersten Modell ablaufen, mehr und mehr.
Einen einzigen Menschen habe ich gekannt, der mir von der ersten bis zur letzten Begegnung an Bewunderung abnötigte, die sich hielt, bis zum letzten Mal, als ich ihn sah. Philosoph mehr von Geburt als von Beruf, war er mir und vielleicht auch anderen stets der Anlass, sich dankbar zu fühlen.
Dieser Mensch war Helmuth Plessner.
Ein Unglück war daran schuld, dass wir Plessner kennenlernen konnten.
Unerwartet starb (im Februar 1965) Hans Barth. Der verehrte Lehrer war Professor für politische Philosophie gewesen, und ein Nachfolger in dieser Spezialität war nicht in Sicht. Gesellschaftsbewusstes und gesellschaftsbezogenes Denken war zwar gerade im Begriff, Mode zu werden. Aber um Barth und seinen überlegenen Liberalismus hatte sich keine Schule scharen können. Die Suche nach einem neuen Lehrer wurde langwierig und enttäuschend.
Dafür rief man berühmte emeritierte (pensionierte) Philosophen aus Deutschland an die Universität. Zuerst Löwith, der mit beissender Ironie seine letzte grosse Vorlesung gegen die gesamte metaphysische Tradition Europas hielt - ihm war die Welt 'nicht die Welt des Menschen' -, dann zunächst für ein Semester, und dann wieder und wieder Helmuth Plessner. Er war schon über siebzig Jahre alt, doch liess er sich von seinem Alterswohnsitz Erlenbach rufen.
Selten ist eine Verlegenheitslösung so gut geraten.
Körperlich war Plessner klein, sein Kopf allerdings gross und konzentrierte Kraft ausstrahlend. Sein Blick war lebhaft und an-ziehend. Nichts an ihm war herrscherlich, wie wir es an Bloch oder Löwith spürten. So wie er lehrte, war er wirklich: von 'natürlicher Künstlichkeit'. Eine Hand hatte immer die andere ergriffen, musste sie am Körper festhalten: Die Behinderung liess um so eindrücklicher fühlen, wie frei Plessner dachte und sprach. Es gab kaum einen, der auf so hohem Niveau völlig frei zu formulieren vermochte: Er sprach denkend.
Plessner war nie langweilig. Was immer seinen Geist beschäftigte, wurde ihm selbst und seinen Zuhörern lebendig. Mit einer unverwechselbaren, ihm eigenen ironischen Bescheidenheit konnte er zugleich spüren lassen, dass das Vor-Denken schon viel schwerer sein musste als unser Nach-Denken. Dass er es nicht nötig hatte, uns zum Beweis seiner Ueberlegenheit zu langweilen, deutete er durch die wiederholte Erzählung von seinem bewunderten Lehrer Husserl an. Dieser konnte zur Darlegung einer Methode über Vorlesungsstunden hinweg einfach nur von dem Bleistift sprechen, den er vor sich in der Hand hielt ('Wie tödlich könnte Husserl uns langweilen mit seinen 'Abschattungen'...').
Die erste Vorlesung galt Hegels 'Phänomenologie', einem bekanntlich sehr schwer verständlichen Buch. Er las es mit uns, einfachere und schwierigste Partien. Diese Vorlesung gab mir ein neues Bild von einem 'guten Lehrer': Ohne didaktische Zubereitungen und Umwege, ohne besondere Erklärungen las er einfach vor. Indem Plessner las, wurden die verschlossensten Geheimnisse des Werkes plötzlich klar und durchsichtig. Seither ist das ein Ideal für mich: So beiläufig zu lehren, wie er Hegel vermittelte.
Am Ende der 'Phänomenologie des Geistes' wurde - ein erstes Mal in Hegels Werk - die Entfremdung aufgehoben; der Geist kehrt in seiner Geschichte vollkommen in sich selbst zurück. Wie Plessner dies las, was doch seiner eigenen Philosophie so vollkommen entgegengesetzt stand, das war ein Kunststück sondergleichen. Er hatte vorher das Buch oft genug gegen dieses Ziel in Schutz genommen, hatte Hegel vor dem Missverständnis geschützt, das in der Harmonie solcher Rückkehr liegt. Vollkommen war ihm Hegel darin, dass er als erster imstande war, 'die Abschaffung seiner eigenen Philosophie gleich mit seinen Gedanken mitzudenken!' Wenn er nun die andere Seite, die versöhnende Kraft des Hegelschen Gedanken darstellen musste, so konnte er sich selbst nicht verleugnen. Noch im Höhepunkt des absoluten Wissens sah Plessner die Vollendung des Skeptizismus - Philosophie als 'Verzweifeln lernen' - und da, wo Hegel die Formulierung braucht, dass die Erinne-rung die Schädelstätte des absoluten Geistes genannt werden kann, brach Plessner in Tränen aus. Nun muss man wissen, dass Plessner sein Leben lang über Lachen und Weinen geforscht hatte. Weinen war ihm scheinbarer Ausdruck, wo nichts mehr auszudrücken war: Plessner wollte nichts sagen zum Höhepunkt der idealistischen Philosophie, die er für Illusion nehmen musste, und weil er nichts dazu sagen durfte, musste er weinen.
Lachen und Weinen waren in seinen Vorlesungen oft Thema. Er wiederholte dabei nicht nur die berühmt gewordenen Analysen seines Buches, sondern versuchte diese 'Zusammenbrüche unserer Ausdrucksstrebung' immer wieder neu anzugehen. Dass dabei viel gelacht werden konnte, war selbstverständlich. Witziges Enttäuschen von gut vorbereiteter Erwartung: das verstand er. Alles lebte von einer feinen, an Glück grenzenden Selbstironie. Sein Witz hatte nie die geringste Beimischung von Verletzung (von 'Humor'). Menschlichkeit, Nähe, Anerkennung: Das verstand er seinen Hörern zu schenken, ohne je den eigenen Stolz und hohen Sinn zu verlieren oder zu verleugnen.
Zu seinem Stolz gehörte es, die tiefe Verletzung und Enttäuschung nicht zu verbergen, die sein Leben geprägt hatte. Andere waren berühmt geworden, berühmter als er, die es nicht verdient hatten. Verkehrte, verführerische Gedanken herrschten, über 1945 hinweg, und stahlen ihm Ruhm und Wirkungsmöglichkeit. Natürlich lebten viele dieser berühmteren Denker jetzt nicht mehr an seiner Stelle, sondern nur noch neben ihm. Aber auch das ertrug er schlecht. Für uns Studenten war das ziemlich verwirrend: Wie ein Mann auf der Höhe seines Ruhmes, so erfolgreich, wie es einer nur wünschen konnte, dauernd enttäuscht war und blieb. Die Unersättlichkeit, die jedem Schreiben einwohnt, und ein nie erzähltes hartes Schicksal zwischen 1933 und 1945 vereinigten sich darin.
Während Plessners Zürcher Semestern wurde der Marxismus im deutschen Sprachgebiet plötzlich wieder 'Mode'. Er sah es, mit Staunen und ohne Abwertung; seine unerbittliche Kritik an unseren Illusionen kleidete er in zarte Formulierungen. Besonderes Vergnügen machte es ihm, wenn er uns zeigen konnte, dass die Strömung der Zeit eigentlich nicht dem neunzehnten Jahrhundert zuneigte, sondern mit jugendfrischer Zuversicht - dem achtzehnten. Leiser Spott begleitete unsere aufklärerische Unrast.
Spannend wurde es, wenn er uns beim Wort nahm. 'Historischer Materialismus' - das sei doch eigentlich eine ausgezeichnete Formel, nur müssten wir dann eben wirklich histo-risch denken und nicht ideologisch, materia-listisch und nicht in unseren Begriffgebäuden.
Die Definition des 'Lebens' aus der Begren-zung führte er uns immer wieder vor. Wie die Zelle durch die Membran zur lebendigen in der nichtlebendigen Umwelt wird - und wohin dieses ausgegrenzte Leben tendiert. Dass der Mensch die Grenze überschreiten muss, 'ausser sich gerät', diese Aussage wurde überall überprüft: in der Kunst, speziell der Musik, in der Gesellschaft und Wissenschaft, in der Sprache und Sprachgeschichte, zuletzt auch in der Philosophie.
Schalkhaft und verhalten-witzig wurde seine Stimme, als er uns in die Einsamkeit des Geistes in der Natur auf die Art einführte, dass er davon abmahnte, was eigentlich die grösste wissenschaftliche Neugier unserer Zeit sein müsste: Nach Mitteilungen geistiger Wesen aus irgendeinem anderen Gestirn zu forschen. Was er meines Wissens vorher nie geschrieben hat, sagte er uns ein einziges Mal: Er könne es für nichts anderes als selbstverständlich ansehen, dass Leben und menschliche, exzentrische Positionalität wohl auch anderswo als auf der Erde entstanden sein müsse. So sehr der Mensch ihm Unikum war in unserem Winkel der Welt, so sehr war er auch zu begreifen und damit prinzipiell nicht einmalig.
Aeltere Lehrer lieben es, ihre Schüler zu rühmen. Plessner bildete keine Ausnahme. Aber er sprach von diesen Jüngern mit Achtung und Verständnis, ohne je so etwas wie eine Schule, eine Wirkungsgeschichte zu konstruieren. Mit uns Studenten hoffte er, Krockow werde nach Zürich berufen werden. Bergers Versuch, die Soziologie neu zu konstruieren, kommentierte er sachverständig und bei aller Begeisterung mit Distanz. Mit seinen siebzig Jahren las er, als wäre er ein Schüler, und sein Verständnisvorsprung war das einzige, was er uns dabei vorführte. Wenn ihn etwas an der neomarxistischen Generation traurig machte, dann war es unser Mangel an Neugierde auf das Aktuell-ste. So fest er an seiner in den Zwanzigerjahren entwickelten Anthropologie festhielt, so lebendig und offen war er für das jeweils Neueste.
Einer seiner erfolgreichsten Schüler war damals Bundesminister in Deutschland. Als einmal im Gespräch ein politisches Problem auftauchte - es ging um das Verhältnis zu Osteuropa, um Krieg und Frieden, um die damals noch nicht anerkannte Abtretung der seit 1945 polnisch und sowjetrussisch gewordenen Teile Deutschlands - und ein Student eine Lösung vorschlug (eine stu-dentische, aber ausnahmsweise einfache und einleuchtende Idee), sagte Plessner spontan: 'Das müssen wir dem Ehmke schreiben!' Ich zweifle nicht daran, dass er es getan hat, und dass er daran glaubte, dass ein solcher Brief, 'Strukturwandel der Oeffentlichkeit' hin oder her, die Geschichte beeinflussen könnte.
Gleich nach dem Erscheinen der 'Negativen Dialektik' von Adorno lud er einen Kreis von Studenten in sein Haus ein, um in wöchentlichen Gesprächen das Buch durchzustudieren. Während er Horkheimers Aeusserungen in jenen Tagen mit Spott und Kopfschütteln aufnahm, fühlte er sich durch Adornos Spätwerk herausgefordert. Dieses 'Denken gegen das Denken' interessierte ihn, ohne ihn im geringsten zu faszinieren. Was darin marxistisch oder hegelisch sein mochte: Er erkannte und klärte es, zeigte auch, wie Adorno sehr weite Umwege brauchte, um zum von vornherein als richtig Erkannten zu kommen. Was aber kantisch war, zum Beispiel in der Erscheinung dessen, was bei Marx als 'Natur' der Gesellschaft bezeichnet wird (bei Kant 'realer Schein', die Urform der Ideologie, die wir so gut kennen und zu durchschauen meinen), das hob er hervor als das für ihn Wertvolle und Definitive der negativen Dialektik.
Die 'Negative Dialektik' als eine essayistische Sammlung von Modellstudien - deren marxistische Gläubigkeit leise und gutmütig verspottet wurde, hat Plessner schliesslich an sehr vielen Stellen anzuerkennen gewusst. 'Das könnte stimmen', hiess dann sein Kommentar, und er tönte nicht unbescheiden.
Während der Wochen, die die Lektüre der Negativen Dialektik brauchte, wählte einer von uns den Freitod. Als ich Plessner davon berichtete, blieb er gefasst. Am Abend erzählte er in seinem unnachahmlichen Ton, wie und worin er den Gegangenen geliebt hatte. Danach arbeitete er mit uns konzentriert und ganz der Sache hingegeben. Aber man spürte, dass da nichts von 'Business as usual' war. Vielmehr erschien uns Plessner als einer, der gelernt hatte, enttäuscht zu sein, ohne die der Enttäuschung vorhergehende Täuschung gebraucht zu haben: So konnte ihm Leid weniger anhaben.
Für einen Lehrer hatte Plessner in seinen späteren Jahren eine weitere nützliche Gabe: Er konnte sich für Menschen, die ihm gefielen, ehrlich begeistern. Dichter, Soziologen, Dirigenten, Politiker: Immer wieder begann er von neuen Leuten zu reden, und immer wieder mit der gleichen ansteckenden Freude: 'Kennen Sie den - der ist doch gut!' Was an der Kritik an Adorno gereift war (und noch früher, im November 1969, im 'Merkur' erschien), war der Aufsatz 'Homo absconditus'. Er wusste genau, wie gut ihm dieser Wurf gelungen war. Unvergesslich sein Schmunzeln, als er mir einen Sonderdruck in die Hand gab mit der Bemerkung: 'Da schauen Sie - mein jüngster Irrtum!'
Hans Hutter (1913)
geschrieben für ihn selbst
Genau erinnere ich mich an unsere erste Begegnung. Unter den in die Jahre gekommenen Freiwilligen des spanischen Bürgerkrieges eine gewiss nicht ungewöhnliche Erscheinung: ein Kopf, der von selbstverständlicher Härte gegen sich selbst und zugleich von tiefer, friedfertiger Liebe zum eigenen Leben wie zu dem der andern zeugte. Ein gutes Gesicht. Mit Liebe breitete er seine Schätze über weite Tische im Zürcher Volkshaus aus: Plakate, Zeitungen, Briefe aus jenen Jahren; Schätze, von denen heute einige mir gehören, und die ich mit meinem sonst gar nicht aufbewahrenden Wesen zu hüten versuche, so gut ich kann. Schliesslich breitete er über alles eine schon oft gebrauchte durchsichtige Haut aus Plastik, damit nichts beschädigt würde und niemand in Versuchung komme. Ein ganz einfacher Mensch, aber mit ganz ungewöhnlichem Horizont.
Winterthur, Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts: Stadt der Musik, Stadt der Gärten, Stadt der Kunstsammler, Stadt der Arbeiter, Stadt des Fortschritts, Stadt der demokratischen Bewegung. Puritanismus, über alle vergleichbaren Beispiele gesteigert. Für viele, die hier aufwachsen, ein hartes Pflaster, und doch mit Sicherheit als die beste aller möglichen Welten zu erkennen. Es scheint Glück und Verpflichtung, aus dieser Stadt zu stammen. Das wichtigste, so will es mir vorkommen, doch die Demokratie. Eine Bewegung, die selbst Gottfried Keller zum Erstaunen gebracht hat, noch nach hundert Jahren lebendig, jedem anzumerken, der vor dem zweiten Weltkrieg hier geboren wurde, auch Max Meier oder eben beispielsweise Hans Hutter. Für und heutige: Vergangenheit, verdorben, wie so vieles, was einmal die Schweiz gewesen war. Winterthurer wurden in Hutters Jugendzeit Schlosser oder Dreher, Maschinenmechaniker oder Giesser. Er aber blickte in die Zukunft, wurde Automechaniker. Er hoffte auf eine Zeit, wo alle in die Ferne reisen könnten. Die Ferne zog ihn an, freilich keine abstrakte Ferne, sondern von Anfang an, und dann sein Leben lang Spanien. Es zehrte in ihm so stark wie ein Heimweh nach diesem Land, ohne dass er hätte sagen können, woher ihm dieses Schicksal zufiel. Als Demokrat bewegte ihn das Schicksal jedes überfallenen Landes, zum Beispiel Polens und Finnlands; aber er hätte da niemals hingehen wollen, sein Gehen war nur oberflächlich eine politisch-bewusste Entscheidung, schon gar nicht suchte er Helfer- und Heldentum.
Auf Spanien war er in La Chaux-de-Fonds gekommen, wo er seine Automechanikerlehre gemacht hat. Es war ihm zunächst selbst nicht bewusst, was er tat; er glaubte an sich selbst und wollte nicht nur eine Fremdspra-che beherrschen, ging darum in den Jura und dort, kaum dass er sich auf Französisch einigermassen verständigen konnte, in einen spanischen Sprachkurs. Ob er etwas ahnte vom Rückkehrer Humbert Droz? Vom Geist Bakunins? Oder ob es einfach der Stadtplan dieser eigenartigen Siedlung war, der im Schulatlas so deutlich die Sprache der Vernunft zu sprechen schien, und durch den hindurch vielleicht der gleich regelmässige, gleich orientierte Stadtplan von Barcelona zu ihm redete? Er wusste es nicht zu sagen und weiss es wohl heute noch nicht. Denn an Schicksal zu glauben, lag und liegt dem verantwortungsfreudigen Demokraten fern.
Natürlich wollte er eine bessere Welt, aber so selbstverständlich, wie das für einen jungen Menschen nur sein kann. Er tastete herum, suchte nach der Vernunft, und hing wohl mehr als einen Moment an Vorstellungen der richtigen Ernährung, der Freiheit von Suchtmitteln. Kein Fleisch, kein Alkohol, kein Tabak: Vernünftige Reform schien solches zu gebieten. Dann hörte er, Adolf Hitler hänge diesen Idealen an: "Da erkannte ich, dass es daran nicht liegen kann." Freilich blieb ihm sein Leben lang das Verhalten und Aussehen eines beherrschten Menschen. Zur Lebensfreude kehrte er zurück, aber als Schlemmer oder sonstwie masslosen Menschen hat ihn wohl nie jemand gesehen, auch nicht im Krieg.
Neid könnte es erwecken, wenn man ihn erzählen hört von den vielen "grossen" Menschen, die er im Bürgerkrieg erleben und kennen lernen durfte. Aber seine Erzählungen haben einen ganz anderen Klang als die meisten Kunstwerke, die dieser Krieg hervorgebracht hat, einige Seiten von Regler und von Orwell vielleicht ausgenommen. Er bewertete die Menschen anders als die Schriftsteller, die von ihren Ideen nicht freikamen, mit den Masstäben eines Winterthurer Demokraten und den Augen der spanischen Menschen, die die Opfer des Krieges waren. Jene waren ihm gross, die frei blieben von aller "Grösse" und aller Melancholie, von Verachtung und Herrschsucht, von Hass und Rechtfertigung.
Es gibt kein Leben ohne (schlechtes) Gewissen, und die Beschäftigung mit dem, wogegen sich das Gewissen geregt hatte, machte auch für ihn die Arbeit eines Lebens aus. Dass er ohne ein Wort des Dankes oder der Entschuldigung seinem Lehrmeister weggelaufen war, in der gar nicht sicheren Hoffnung, man werde ihn nicht mehr erwischen, bevor er in Barcelona sei, gerufen von einem Brief des Bruders, der erklärte, man brauche jeden, der etwas von Autos verstehe, beschäftigte ihn sein Leben lang. Dass er, der für die Rote Hilfe hatte fahren wollen, nun aber eben als Panzerkommandant nötiger gebraucht wurde und so zum Soldaten wurde, war ihm problemloser als die "weniger schlechte Entscheidung", zu der ihn das Leben zwang. Dass aber der Bruder getötet wurde, "vergeblich starb" in dem von Anfang an verlorenen Krieg für das Gute, nagte fort an ihm. Ueberhaupt, dass es keine Hilfe gab gegen den feigen Bombenkrieg, trug er wie eine eigene, ganz persönliche Schuld. Er war im Krieg gewesen, ohne Krieger zu werden, und wie so viele hasste er den Krieg, ohne die eigene Entscheidung für den Widerstand widderrufen zu wollen oder zu können. Dieses Bewusstsein strahlt aus seinem Gesicht, und macht seine Grösse aus.
Schon bei der ersten Heimkehr nahm er ein Waisenkind aus dem bombardierten Barcelona mit, und zwar so selbstverständlich, wie er gegangen war. Und weil er es nicht aus Grundsätzen tat, sondern unmittelbar aus seinem Gefühl, konnten die, denen er half, Spanier bleiben, indem sie sein Leben teilten. Die Frau, die er in Winterthur fand, und die Familie, die er gründete und die ihn in seinem Wesen stützte, zog er wie selbstverständlich in die eine wie die andere Heimat hinein.
Natürlich musste er ins Gefängnis; das nahm er gleichmütig hin. Dass man in der Schweiz den Spanienkämpfern auch nachträglich nie die Anerkennung gab, die sie verdient hätten, war ihm recht. Nur eines schmerzte ihn: es gab ja auch jene, die Franco zu Hilfe geeilt waren - dass diese straflos blieben, verletzte sein Rechtsempfinden.
Nach dem zweiten Weltkrieg baute er einen Betrieb auf, mit dem Automobilismus stieg er zu einer geachteten Persönlichkeit auf, in der Privatwirtschaft, die ihn in seinem Wesen weder prägen noch verändern konnte. Da er tüchtig war, wuchs sein Geschäft, was er sich gönnte. Tiefe Enttäuschung allerdings bedeutete es dann, unter den Arbeitern kein Verständnis zu finden für seinen Versuch, aus der Garage eine freie Assoziation zu machen, eine selbstverwaltete Gemeinschaft, wie das in Katalonien so gut und so selbstverständlich gemacht worden war, 1936.
Schon wenige Jahre nach dem Krieg musste er wieder nach Spanien. Furchtlos ging er an all die Orte, für die er vergeblich gekämpft hatte, wurde sogleich erkannt, in die Häuser genommen, um nun machtlos zu hören, wie das Leben weitergegangen war. Das selbstverständliche Vertrauen in das Volk, zu dem ihn sein Wesen jetzt wie zwölf Jahre zuvor drängte, wurde nicht enttäuscht. Fassungslos hiessen die alten Freunde den willkommen, der so mutig wie einer von ihnen war, keiner hat ihn verraten. So konnte er den Geschlagenen zeigen, dass er weiter auf ihrer Seite stand.
Als ein Mittel, sich und uns zu verstehen, stiess er auf die Geschichte. So unerhört aber seine Dokumente, insbesondere die hellsichtigen Briefe derer waren, die so wie er bald einmal erkannten, dass "etwas nicht stimmen konnte" mit dem Freiheitskrieg der Republik, so genügte ihm die Aufbewahrung und Wiedergabe seines eigenen Weges nicht. Er suchte und fand Zeugnisse von Leuten aus der Schweiz, die nach Spanien gegangen waren in früheren Jahrhunderten, Menschen, mit denen er Gemeinschaft empfand. Reisläufer und Zuckerbäcker, Handwerker und Abenteurer, vor allem aber jene verarmten Bauern des Ancien Régime, die nach Andalusien zogen um entvölkerte, karge Berge zu besiedeln. Ihre Spuren half er sichern, als ob sie von der gleichen Sehnsucht zeugen könnten, die er gehegt hatte, als er dem Ruf des Bruders gefolgt war.
Er war sich auch nicht zu schade für den "Erfolg", in einer neuen Zeit angesehene Offiziere der Schweizer Armee auf "militärhistorischen Studienreisen" dorthin zu führen, wo er gekämpft hatte. Man darf zweifeln, ob diese Herren eine Ahnung davon gehabt haben, wer sie führte. Dass auch er nicht recht wusste, was er tat, belegt sein Erstaunen darüber, dass die fröhliche Reisegesellschaft kein einziges Bauwerk, kein Schloss, keine Kirche und kein Kloster, keine Bibliothek und kein spanisches Dorf besichtigen wollte. Er hätte ihnen mehr bieten wollen und mehr zu sagen gehabt.
Ich habe in den wenigen Jahren, wo ich ein Sozialist zu sein glaubte, Menschen wie Hans Hutter gebraucht, um zu erkennen, "dass es daran nicht liegen kann"; und in der langen Zeit, seit ich kein Auto mehr besitze und gegen meine Fahr- und Lebenslust Selbstbeherrschung lerne, ist er mir so wie andere gute Menschen, die vom Strassenverkehr leben, stets als Mahnung in meiner Seele geblieben, dass uns in unserem Widerspruch nichts weniger ansteht als Fanatismus und Rechthaberei. Er hat seine Ueberzeugungen gelebt, ohne sie andern aufzu-drängen.
Wer mir persönlich etwas zu »Hommages« zu sagen hat, kann hier mailen: dejung@samisdat-dejung.ch
Wer keine Mitteilung machen will, sondern das Buch aus dem Samisdat bestellen will, kann mir das folgende Bestellformular senden.
(zurück zur Startseite des freien Geistes)